
Erneuerbare Energie trifft nachhaltige Aquakultur
AquaEnergy ist ein bundesweites Innovationsprojekt, das das enorme Potenzial schwimmender Photovoltaiksysteme (Floating-PV) auf Aquakultur-Betrieben erschließt. Gemeinsam mit Fachleuten aus Wissenschaft, Praxis und Politik zeigt AquaEnergy, wie die nachhaltige Erzeugung von Strom auf Wasserflächen nicht nur klima- und ressourcenschonend ist, sondern auch neue wirtschaftliche Perspektiven für Fischzuchtbetriebe schafft.
wissenschaftlich fundiert, dialogorientiert und praxisnah
Aqua:Energy begegnet den Herausforderungen mit einem integrativen Ansatz, für eine Energiewende, die auch auf dem Wasser trägt.
Aqua:Energy
Wir machen Aquakulturanlagen zu Kraftwerken der Energiewende. Durch die gezielte Integration von Floating-PV ermöglichen wir:
Doppelnutzung bestehender Wasserflächen
Senkung der Betriebskosten
Schutz von Fischpopulationen vor Überhitzung und Prädatoren
Verbesserte Klimaresilienz und ökologische Synergien
Mit unserem Projekt wollen wir nicht nur Technologien vermitteln, sondern den Strukturwandel aktiv mitgestalten – wissenschaftlich fundiert, politisch verankert und praxisnah gedacht.
-

Publikationen
-

Veranstaltungen
-

Best Practice

Veranstaltungen
“Das Blaue Frühstück hat mir gezeigt, wie sehr die Zukunft der Energie- und Nahrungsmittelproduktion zusammengehört.“
— Forellenzüchter & Teilnehmer beim Blauen Frühstück 2025
Publikationen
Von der Praxis lernen
Praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitung für:
Planung und Genehmigung von Floating-PV
Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit Kostenrechner
Regulatorische Rahmenbedingungen
Best-Practice-Beispiele aus Deutschland und Europa
Die Dokumente sind als Download verfügbar und werden fortlaufend aktualisiert.
Working Paper
-
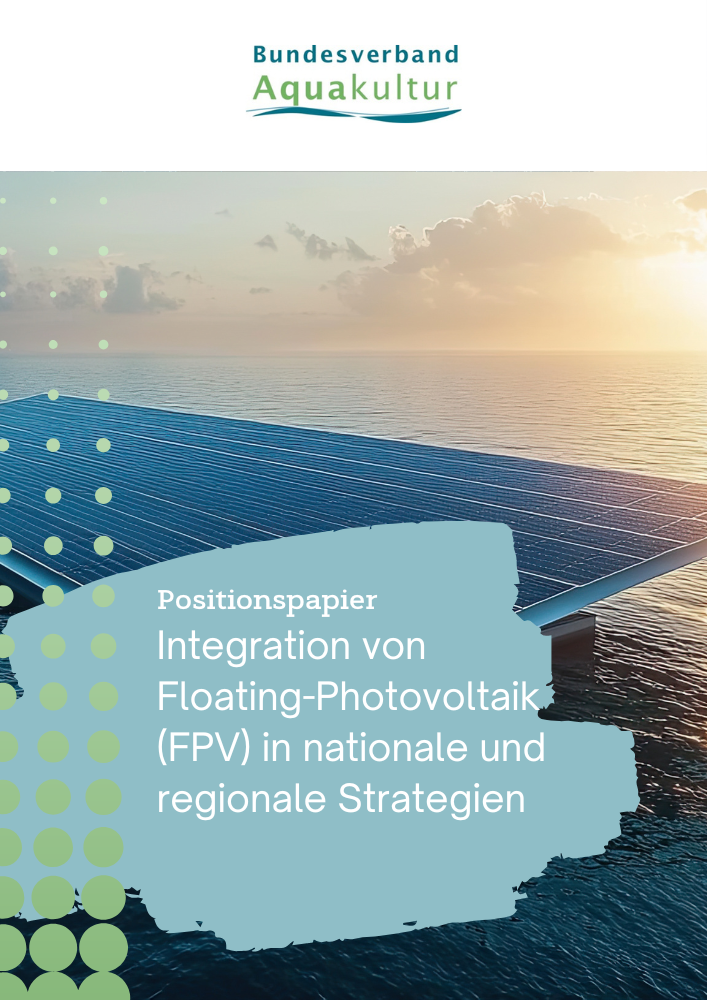
Strategie
-

Harmonisierung
-

Förderung
Die Zentralen Herausforderungen
Floating-PV-Systeme eröffnen neue Möglichkeiten für die nachhaltige Energieerzeugung – besonders auf Aquakultur-Betrieben. Doch der Weg zur flächendeckenden Umsetzung ist mit spezifischen Herausforderungen verbunden.
-
Zulassungsverfahren für Floating-PV sind bislang kaum standardisiert. Zwischen Bundes- und Landesebene existieren erhebliche Unterschiede, etwa in Bezug auf:
Gewässernutzung und Eigentumsverhältnisse
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Genehmigungspflichten im Wasser-, Bau- und Energierecht
Diese fragmentierte Rechtslage führt zu Unsicherheit bei Investoren und Planer:innen.
-
Floating-PV-Anlagen müssen extremen Umweltbedingungen standhalten – von Windlasten über Eisbildung bis zu Fischwanderungen. Insbesondere auf Aquakultur-Teichen sind technische Anpassungen notwendig, z. B. bei:
Anker- und Modulsystemen
Materialverträglichkeit mit Wasser-Ökosystemen
Netzanschluss und Lastmanagement bei schwankender Stromproduktion
-
Während sich erste Pilotprojekte als wirtschaftlich tragfähig erwiesen haben, fehlt es häufig an:
belastbaren Kostenmodellen für kleinere und mittlere Betriebe
angepassten Förderinstrumenten und Finanzierungsmodellen
Erfahrungen zur Kombination mit Speichern oder Direktvermarktung
-
Viele Betreiber:innen sind mit dem Thema erneuerbare Energien vertraut – doch Floating-PV ist neu. Es braucht gezielte Kommunikation und transparente Best Practices, um:
Ängste vor Ertragseinbußen oder Eingriffen ins Ökosystem zu entkräften
Vorteile wie Fischschutz, Schattenwirkung und Nebennutzung zu verdeutlichen
Vertrauen in Technik, Prozesse und Betreiberpartnerschaften aufzubauen


